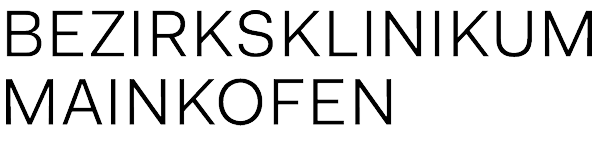Die Euthanasie-Morde und die Geschichte der Gedenkstätte
Das heutige Bezirksklinikum Mainkofen wurde im Jahre 1911 als Heil- und Pflegeanstalt eröffnet. Bau und Behandlungsmethoden waren beispielhaft für die damalige moderne Reformpsychiatrie. Ihr dunkelstes Kapitel erlebte die Einrichtung im Nationalsozialismus. Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Erkrankungen, mit Behinderung, galten als erbbiologisch und gesellschaftlich minderwertig als unnütz und lebensunwert. Über 1300 Männer, Frauen und Jugendliche aus Mainkofen fanden durch das nationalsozialistische Euthanasie-Mordprogramm den Tod.
Nach dem Ende der NS-Herrschaft 1945 dauerte es lange Zeit, bis das Klinikum sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzte. Eine erste Auseinandersetzung fand mit einem Beitrag über Mainkofen im Buch „Psychiatrie im Nationalsozialismus“ von Michael von Cranach statt. Mit viel Engagement Einzelner konnte dann am 28. Oktober 2014 wurde die heutige Gedenkstätte eröffnet. Seither macht das Klinikum aktiv durch Führungen und Veranstaltungen auf die Geschichte des Ortes aufmerksam und gedenkt so der Opfer der NS-Psychiatrie in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt.

Zwangssterilisation
Bereits am 14. Juli 1933 wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ beschlossen, es trat am 1. Januar 1934 in Kraft. In der Folge wurden in Mainkofen bis 1945 mehr als 500 Zwangssterlilisationen an wehrlosen Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt. Insgesamt sind im Deutschen Reich über 350000 Menschen gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht worden.
Aktion T4
Mit der Aktion T4, benannt nach dem Sitz der Organisationszentrale in der Tiergartenstraße 4 in Berlin, begann 1940 die erste Phase planmäßig durchgeführter Tötungen schwer kranker Menschen. Anhand der Meldebögen aus den Heil- und Pflegeanstalten entschieden Gutachter darüber, ob der oder die Betroffene in der Gaskammer einer der sechs reichsweit eingerichteten Tötungsanstalten ermordet werden sollte. In die Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz wurden nach heutigem Wissensstand zwischen 28. Oktober 1940 und 4. Juli 1941 in fünf Transporten 606 Patienten aus Mainkofen verlegt und 604 davon getötet. Die geheime Reichssache T4 wurde aufgrund zunehmender Kritik, insbesondere durch die Predigt des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen am 3. August 1941, am 24. August 1941 eingestellt.
Auszug aus der Predigt vom 3. August 1941:
Andächtige Christen! In dem am 6. Juli dieses Jahres in allen katholischen Kirchen Deutschlands verlesenen gemeinsamen Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom 26. Juni 1941 heißt es unter anderem: „Gewiss gibt es nach der katholischen Sittenlehre positive Gebote, die nicht mehr verpflichten, wenn ihre Erfüllung mit allzu großen Schwierigkeiten verbunden wäre. Es gibt aber auch heilige Gewissensverpflichtungen, von denen niemand uns befreien kann, die wir erfüllen müssen, koste es, was es wolle, koste es uns selbst das Leben: Nie, unter keinen Umständen darf der Mensch außerhalb des Krieges und der gerechten Notwehr einen Unschuldigen töten.“ Ich hatte schon am 6. Juli Veranlassung, diesen Worten des gemeinsamen Hirtenbriefes folgende Erläuterung hinzuzufügen: “Seit einigen Monaten hören wir Berichte, dass aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden. Regelmäßig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, der Kranke sei verstorben, die Leiche sei verbrannt, die Asche könne abgeliefert werden. Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, dass diese zahlreichen unerwarteten Todesfälle von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, dass man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe sogenanntes lebensunwertes Leben vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert. Eine furchtbare Lehre, die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen will, die die gewaltsame Tötung der nicht mehr arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel, unheilbar Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt!“ Wie ich zuverlässig erfahren habe, werden jetzt auch in den Heil- und Pflegeanstalten der Provinz Westfalen Listen aufgestellt von solchen Pfleglingen, die als sogenannte unproduktive’ Volksgenossen abtransportiert und in kurzer Zeit ums Leben gebracht werden sollen. Aus der Anstalt Marienthal bei Münster ist im Laufe dieser Woche der erste Transport abgegangen!
(Euthanasiepredigt vom 3.August 1941 des Bischof von Münster Clemens August von Galen)
Dezentrale Tötungsmaßnahmen
In der zweiten Phase desnationalsozialistischen Euthanasie-Programms wurde dezentral in den Anstalten und Heimen durch Überdosierung von Medikamenten, Nichtbehandlungen von Krankheiten, Kälte und Hunger getötet. In Mainkofen kam der sogenannte „Bayerische Hungerkosterlass“ vom 30. November 1942 zur Anwendung. Durch eine völlig fleisch- und fettlose Ernährung tötete man 762 Patienten in wenigen Monaten durch Entkräftung – man ließ sie verhungern
Klingendes Gedenken
Zur Einweihung dieser Gedenkstätte 2014 wurden vier Miniaturen für Saxophon-Quartett geschaffen. Zeitgenössische Musik und moderne Instrumente, insbesondere das Saxophon, waren im Nationalsozialismus verpönt. Umso mehr will diese Musik den Opfern eine Stimme geben. Die Einspielung der Komposition erklingt bei geführten Besichtigungen des Gedenkraums in der ehemaligen Leichenhalle.
Philipp Ortmeier (*1978): Sonatine für Saxophon-Quartett
Interpreten: Franziska Forster, Steffi Kreilinger, Nico Graz, Martin Jungmayer
Aufnahme: Stefan Lang
Führungen
Sollten Sie Interesse an einer Gedenkstättenführung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
gedenkstaette@mainkofen.de
Angebote für Schulklassen finden Sie unter www.musbi.de
Rechercheanfragen senden Sie bitte an: sekretariat-krankenhausdirektor@mainkofen.de
Opferangehörige, die einen Rechercheantrag stellen möchten, erhalten ihn hier als PDF-Datei zum Download.
Sie können das Formular mailen, faxen oder mit der Post schicken.
Bezirksklinikum Mainkofen
Krankenhausdirektion
Mainkofen A 3
94469 Deggendorf
Tel.: 09931 87 30000
Fax: 09931 87 30099